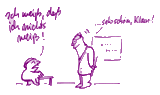 |
Eigentlich wollte ich im Leben nie mehr etwas mit Pädagogik zu tun haben. Meine Schulerfahrungen waren verheerend. Und meine Abneigung gegenüber allem, was mit Pädagogik und Pädagogen zu tun hat, entsprechend herzhaft. »Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt« – sagte man früher bei uns. Es kam anders. Die altbackene Art der Belehrung und Bewertung zu bekämpfen und Alternativen zu entwickeln wurde zu einem Lebensthema, das mich bis heute nicht mehr losgelassen hat.
»Sone und solche«
In meinem zweiten Leben – nach einem wunderbaren Ausflug in künstlerische Arbeitsbereiche – gründete ich mit einer Gruppe Gleichgesinnter eine Schule der anderen Art. Mit fächerübergreifendem und Projektunterricht, mit einem Höchstmaß an Selbstbestimmung für die Schülerinnen und Schüler, mit regelmäßiger Beurteilung der Leistungen von Pädagogen und der Konsequenz: Lehrerwahl und -abwahl.
Das war Anfang der siebziger Jahre, die man auch gut »Gründerjahre« nennen könnte, denn es war eine Zeit des Aufbruchs. Damals gab es viele Versuche, die überkommenen Bereiche der institutionellen Bildungsarbeit zu entstauben und neuen Erkenntnissen zum Durchbruch zu verhelfen: Lernen steht nicht im Gegensatz zu Lebensfreude und Leistung nicht im Gegensatz zu eigenem Interesse. Ganz im Gegenteil.
»Lust und Leistung sind Zwillinge«, diesen Satz aus dem Film »Lob des Fehlers« von Reinhard Kahl – der Film stammt, glaube ich, aus den achtziger Jahren – hatten damals schon viele Pädagogen begriffen. Und manche machten sich auf den Weg, Neues auszuprobieren. In Kita und Schule.
Neue Konzepte wurden entworfen und weiterentwickelt, Zusammenarbeit wurde geprobt, die Arbeit reflektiert, und Veränderungsprozesse wurden zur Normalität. In machen Teams. Andere blieben resistent. Seit damals gibt es »sone und solche«.
Reformschulen entstanden, die stets – und seit PISA wissen es alle – nachgewiesen haben, dass es stimmt: Erfolgreiches Lernen braucht vor allem eine andere Lernkultur, eine Kultur, in der Neugier, Lernfreude und Engagement gedeihen, eine Kultur von Offenheit und Respekt, Aufmerksamkeit und Differenzierung. Eine lernfreudige Kultur ist abhängig vom Willen und der Fähigkeit der Pädagogen. Dort, wo Kolleginnen und Kollegen sich auf den Weg machen, selbst gegen dominante gesellschaftliche Strömungen eine solche Kultur zu gestalten und zu leben, hat die ursprüngliche Lust am Lernen und am Entdecken der Welt eine viel größere Chance, zu überleben. Auf allen Seiten.
Diese Erfahrung bestätigte sich in den letzten zwanzig Jahren, in meinem dritten beruflichen Leben, immer wieder. Ich arbeitete überwiegend im Bereich der vorschulischen Bildung und beobachtete, wie sehr die Lebens- und Arbeitssituationen in den Kindergärten sich unterscheiden – bei weitgehend gleichen Rahmenbedingungen.
Eine Galeere voller Geister und Wiedergänger
Damit bin ich wieder beim Ausgangspunkt: Pädagogen versenken.
Ich muss zugeben, dass meine Abneigung gegen den Begriff »Pädagogen« mit meinen ureigensten Assoziationen zu tun hat: Pädagogen als Besserwisser und Rechthaber, als Bewerter und Verurteiler, als Fehlerverfolger und Niedermacher. Ohne den Hauch eines Zweifels an ihrer Überlegenheit und voller Überzeugung, zu wissen, was gut und richtig ist. Pädagogen, die lebenslang am längeren Hebel sitzen, die ihre Macht hemmungslos missbrauchen, Kinder und Jugendliche demütigen, Eltern kuschen lassen – und selbst als wandernde Senioren auf Gomera noch unschwer zu identifizieren sind.
Menschen, die von Berufs wegen andere belehren und selbst nichts mehr lernen wollen; die ihre Schutzbefohlenen jahraus, jahrein mit demselben »Stoff« langweilen und deren Zeit vergeuden; die erwarten, dass die »richtigen« Antworten gegeben werden und keine anderen gelten lassen; die unangefochten und ungesehen hinter ihren Klassen- oder Gruppentüren schalten und walten nach Gutsherrenart. Pädagogen mit eingebautem erhobenen Zeigefinger und Defizitbrille; die Fehler mit der »roten Tinte der Inquisition« verfolgen – wieder so ein treffendes Bild aus »Lob des Fehlers«.
Humorlose, graue Gestalten, die jahraus, jahrein an grauen Tafeln das Gleiche verkünden und deren Leben dabei auch ganz grau wird; die vom Burn-out gebeutelt werden und einem eigentlich leid tun könnten, wenn... Ja, wenn sie nicht selbst die Verantwortung dafür tragen würden, dass Lernen so unerfreuliche Formen annimmt. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, wenn ich sehe, wie die Würde von Schülern missachtet wird, wie diese Pädagogen Kinder vorführen und beschämen, stigmatisieren und aussondern; wie sie für alles eine Schublade oder einen Schuldigen parat haben – nur nicht die eigenen Haltungen überprüfen oder ihre Methoden in Frage stellen.
Lehrerinnen und Lehrer, die unverdrossen erwarten, dass die Kinder schulfähig gemacht werden, statt sich darum zu kümmern, was »Kinderfähigkeit« für (Grund-)Schule unter heutigen Bedingungen bedeutet. Erzieherinnen und Erzieher, die in vorauseilendem Gehorsam darauf einsteigen und den unseligen Kreislauf weiter stabilisieren. Tanten und Onkels, die Lehrererwartungen nach so ungeheuer zukunftsträchtigen Schlüsselkompetenzen wie »Schnürsenkel binden« oder »Stift und Schere halten« unbedingt erfüllen wollen, weil: sonst lernen die Kinder das nicht, die Kinder darum im letzten Jahr vor der Schule »rausziehen« und darauf trainieren, still zu sitzen, Anweisungen zu folgen und sich zu konzentrieren – egal, wie langweilig das Angebot ist. Leute also, die Kindern klarmachen wollen: Jetzt ist Schluss mit lustig!
»Der Ernst des Lebens« und das Drama der bundesdeutschen Dreigliedrigkeit wirft lange Schatten voraus. Die alte Schule lebt – und überlebt mit vereinten Kräften. Aussonderung hat System.
Oh ja, mir fallen jede Menge Scheußlichkeiten ein, erlebte und aufgespießte1, Scheußlichkeiten, die auch heute noch, 30 Jahre nach unserem damaligen Aufbruch, ungestraft passieren können, weil das kollektive Denken dies begünstigt: Wer nicht pariert oder wer nicht ins Raster passt, fliegt raus.
Diese alltäglichen Scheußlichkeiten lösen den Impuls in mir aus, die ganze Pädagogenmischpoke auf ein Geisterschiff zu sperren, weit aufs Meer hinaus zu scheuchen und sie dort endgültig zu versenken. Eine Reise ohne Wiederkehr. Damit wenigstens meine Enkel nicht mehr damit rechnen müssen, ihnen oder ihren Wiedergängern zu begegnen.
Eine Segelyacht voller Schatzsucher und Lebenskünstler
Aber es fallen mir auch andere Pädagogen ein: solche, die sich selbst als Lernende verstehen, die sich der Kritik stellen und Rückmeldungen suchen; denen es nicht nur darauf ankommt, verstanden zu werden, sondern vor allem zu verstehen; die sich in die Perspektive ihres Gegenübers einfühlen und unterschiedliche Sichtweisen zulassen; die sich zurücknehmen und ihre Wichtigkeit nicht überschätzen; denen die Lebensfreude der Kinder und Jugendlichen wichtiger ist als ihre Disziplin; die sich in einen echten Dialog begeben und zuhören können, die sehen, was Kinder leisten und können wollen; die ihre Gefühle ernst nehmen und Kindern die Deutungshoheit über das, was ihnen im Leben wichtig ist, zurückgeben. Pädagogen, die unterscheiden und Position beziehen, die klar sind und zugleich neugierig und offen für neue Ideen, die Freude an ihrer Arbeit haben und Lebensfreude verbreiten; die nicht immer nur auf ein unbestimmtes Morgen »vorbereiten«, sondern sich um die Gegenwart bemühen. Pädagogen, die fachlich auf der Höhe der Zeit sind und wissen, dass Bildung immer etwas Eigenes ist, also nicht »gemacht« werden kann; die wissen, dass Bildung mit der Geburt beginnt und nicht erst in der »Vorschule«; die wissen, dass Bildungsprozesse immer und überall stattfinden und nicht nur zu bestimmten »pädagogischen« Zeiten. Pädagogen, die ihre Rolle so definieren: als Verantwortliche für die Gestaltung einer anregenden und herausfordernden Lebensumwelt; die ihren Auftrag zum »Beibringen«2 so verstehen: Lieferanten von »Hirnfutter« für bildungshungrige Kinder in Kita und Schule zu sein.
Solche Pädagogen möchte ich natürlich nicht versenken, sondern alle zusammen auf eine große Segelyacht einladen, mit der wir gemeinsam zu neuen Ufern aufbrechen. Denn einzeln rudert es sich schwer an gegen die grauen Wellen der Bequemlichkeit, Angst und Resignation. In einem Boot und mit vereinten Kräften kommen wir besser voran.
Wenn man’s recht bedenkt, sind Visionäre und pädagogische Traumtänzer seit zweihundert Jahren unterwegs – auf internationalen Gewässern, mit mehr oder weniger Rückenwind und durchaus nicht in jedem Hafen dieser Welt willkommen. Viele unserer Vordenker sind lange unter der Erde oder schauen von oben kopfschüttelnd auf uns herab. Wahrscheinlich fragen sie sich: Warum dauert es so lange, bis Erkenntnisse und gute Erfahrungen sich verbreiten?
Die Reise beginnt im eigenen Kopf
In meinem Kopf sitzt das Bild vom »grauschwarzen Pädagogen«, der »am Kind arbeitet«3. Deshalb laufe ich Gefahr, der Verengung des Begriffs »Pädagogik« auf Schule und damit dem Elend dieser Verengung Vorschub zu leisten. Dabei ist Pädagogik viel weiter zu fassen. Als Erziehungswissenschaft geht sie den Fragen nach, wie Kinder in die Gesellschaft hineinwachsen und welche Verantwortung wir Erwachsene dafür tragen. Beim Nachdenken über diese Fragen sind viele Reformideen entstanden, auf die wir uns heute beziehen.
Ganz klar: Die Pädagogik als gesellschaftskritische Wissenschaft gehört aufs Traumschiff. Der Geist der Reformer reist sowieso immer mit. Und manch ein Visionär oder Ideengeber ist quicklebendig auf großer Fahrt dabei. Geben wir also besser zwei, drei Schiffe in Auftrag. Vielleicht wird eine ganze Armada daraus. Eine Flotte pädagogischer Traumschiffe für Schatzsucher und Lebenskünstler, Optimisten und Kämpfer, Menschen, die sich ihr inneres Kind und ihre Fantasie erhalten haben und die gemeinsam mit anderen noch etwas bewegen wollen. Das ist es.
Wer kommt mit? Und: Wie nennen wir die Schiffe? Auf Vorschläge warten
Gerlinde Lill und die Redaktion
PS: Noch ein Blick zurück, und zwar von Bert Brecht: »Während meines neunjährigen Eingewecktseins in einem Augsburger Realgymnasium ist es mir nicht gelungen, meine Lehrer wesentlich zu fördern.« G. L.
PPS aus aktuellem Anlass:
Nach dem Hilferuf der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln schlagen die Wogen hoch. Zwei Themen werden in den Medien und auch in Familien, Kneipen und im Fitnessstudio diskutiert: die Integrationspolitik und die Bildungspolitik.
Wie eh und je gibt es zwei Lager. Das eine reagiert nach dem alten Muster: Wegsperren, aussondern, abschieben, denn so was wollen wir hier nicht. Wer hier lebt, muss sein wie wir. Oder zumindest unserem Wunschbild entsprechen. Also: Druck und Daumenschrauben. Dann wird’s schon werden.
Offene Fragen? Nein, nur die ewig gestrigen Antworten.
Das andere Lager, zu dem ich mich zähle, fragt weniger: Wer ist (hier) nicht »richtig«? Sondern statt dessen: An welchen Stellen sind wir nicht »richtig«? Was zeigen uns diese Jugendlichen? Wenn sie so sehr aus dem Rahmen fallen – wie sieht der Rahmen denn aus? Was haben sie bisher erlebt, dass sie einen solchen Blick auf das Leben haben? Welche Zukunftsperspektiven, welche Lebensentwürfe, welche Träume haben sie? Was teilt uns ihr Verhalten über den Zustand unserer Gesellschaft mit? Und was können wir tun? Statt: Wer ist Schuld?
Was können wir tun, damit jedes Kind eine Chance hat, in diese Gesellschaft hineinzuwachsen, sich zugehörig und angenommen zu fühlen? Was können wir tun, damit Selbstvertrauen, Eigenverantwortung und Zukunftsoptimismus gedeihen? Welche Bedingungen sind notwendig, damit Solidarität entsteht? Wie können wir Kinder und Jugendliche erleben lassen, dass es sich lohnt, sich einzusetzen – für sich und andere? Wie erwecken wir demokratische Grundorientierungen zum Leben?
Eine Reise auf dem Traumschiff – schön und gut. Vor allem aber müssen wir uns einmischen, Position beziehen, praktische Alternativen entwickeln und aus erfolgreichen Projekten lernen. Auf dem Land und auf der See müssen wir Kurs auf ein Ziel halten: Alle sind wichtig, alle gehören dazu. Niemand wird ausgesondert. Das ist Integrations- und Bildungspolitik gleichermaßen. Und Politik kann man nur gemeinsam machen. Auf geht’s.
G. L.
1 Siehe »Das Allerletzte« seit Heft 6-7/05
2 Siehe: Heft 7/04, S. 28
3 Siehe: Heft 1/05, S. 24




